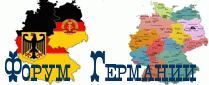
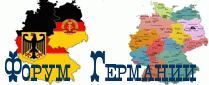 |
1929
Remarque erringt einen Welterfolg mit seinem Roman "Im Westen nichts Neues", der das Tabu vom Heldentod der Soldaten bricht. Er spricht darin von der "verlorenen Generation, die vom Krieg zerstort wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam". In Deutschland lost der Roman heftige Kontroversen aus. 1930 Verfilmung von "Im Westen nichts Neues". 1932 April: Remarque lasst sich in der Schweiz nieder. 1933 10. Mai: Im Zuge der von den Nationalsozialisten inszenierten Bucherverbrennung wird auch "Im Westen nichts Neues" aus offentlichen Bibliotheken entfernt. 1937 In London erscheint Remarques Roman "Three Comrades", der ein Jahr spater in Amsterdam in deutscher Sprache veroffentlicht wird. 1938 Aberkennung der deutschen Staatsburgerschaft. 1939 Remarque emigriert in die USA. 1941 Veroffentlichung des in englischer Sprache geschriebenen Romans "Flotsam" in London, der auf deutsch in Stockholm unter dem Titel "Liebe Deinen Nachsten" erscheint. 1945 Nach dem Zweiten Weltkrieg lebt Remarque abwechselnd in New York und in Porto Ronco (Schweiz). 1946 Mit der Veroffentlichung des Emigrantenromans "Arch of Triumph" in den USA hat er einen weiteren weltweiten literarischen Erfolg, an den er mit seinen folgenden Werken jedoch nicht anknupfen kann. 1947 Remarque nimmt die amerikanische Staatsburgerschaft an. 1952 Publikation des Romans "Der Funke Leben". 1954 Der zeitlich im nationalsozialistischen Deutschland angesiedelte Roman "Zeit zu leben und Zeit zu sterben" erscheint. 1956 Remarque veroffentlicht den zur Zeit der Weimarer Republik spielenden Roman "Der schwarze Obelisk". 1963 Der Roman "Die Nacht von Lissabon" wird veroffentlicht. 1967 Verleihung des Gro?en Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland. 1970 25. September: Erich Maria Remarque stirbt in Locarno. 1971 Sein letzter Roman "Schatten im Paradies" erscheint postum. |
Erich Maria Remarque 1898-1979
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1898 22. Juni: Erich Maria Remarque (eigtl. Erich Paul Remark) wird als Sohn des katholischen Buchdruckers Peter Remark in Osnabruck geboren. Seine Ausbildung erhalt er am Katholischen Lehrerseminar der Stadt. 1916 Einberufung zur Armee. 1917 Juni: Nach sechs Monaten Ausbildung wird er im Ersten Weltkrieg an der Westfront eingesetzt. Juli: Aufgrund einer Verletzung durch Granatsplitter bleibt er bis Oktober 1918 in einem Duisburger Lazarett. 1918 Nach Kriegsende versucht sich Remarque in verschiedenen Berufen. Er ist als fliegender Handler, Agent fur Grabsteine, Organist, Volksschullehrer und als Theater- und Konzertkritiker bei der "Osnabrucker Tageszeitung" tatig. Er veroffentlicht Gedichte und Kurzprosa. 1920 Publikation seines Kunstlerromans "Die Traumbude". 1923/24 Als Redakteur einer Werkzeitschrift bereist Remarque die Schweiz, Jugoslawien, die Turkei, Italien, England und Belgien. 1925 Redakteur der Berliner Zeitung "Sport im Bild". |
Heinrich Christian Wilhelm Busch (* 15. April 1832 in Wiedensahl; † 9. Januar 1908 in Mechtshausen) war einer der einflussreichsten humoristischen Dichter und Zeichner Deutschlands. Seine erste Bildergeschichte erschien 1859. Schon in den 1870er Jahren zahlte er zu den bekannten Personlichkeiten Deutschlands. Zu seinem Todeszeitpunkt galt er als ein „Klassiker des deutschen Humors“[1], der mit seinen satirischen Bildergeschichten eine gro?e Volkstumlichkeit erreichte. Er gilt heute als einer der Pioniere des Comics. Zu seinen bekanntesten Werken zahlen die Bildergeschichten Max und Moritz, Die fromme Helene, Plisch und Plum, Hans Huckebein, der Unglucksrabe und die Knopp-Trilogie. Viele seiner Zweizeiler wie „Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr“ oder „Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich“ sind zu festen Redewendungen im deutschen Sprachgebrauch geworden. Seine Satiren verspotten haufig Eigenschaften einzelner Typen oder Gesellschaftsgruppen. So greift er in seinen Bildergeschichten die Selbstzufriedenheit und zweifelhafte Moralauffassung des Spie?burgers und die Frommelei burgerlicher und geistlicher Personen an.
Busch war ein ernster und verschlossener Mensch, der viele Jahre seines Lebens zuruckgezogen in der Provinz lebte. Seinen Bildergeschichten, die er als „Schosen“ bezeichnete, ma? er wenig Wert bei. Sie waren am Beginn fur ihn nur ein Broterwerb, mit denen er nach einem nicht beendeten Kunststudium und jahrelanger finanzieller Abhangigkeit von den Eltern seine druckende wirtschaftliche Situation aufbessern konnte. Sein Versuch, sich als ernsthafter Maler zu etablieren, scheiterte an seinen eigenen Ma?staben. Die meisten seiner Bilder hat Wilhelm Busch vernichtet, die erhaltenen wirken haufig wie Improvisationen oder fluchtige Farbnotizen und lassen sich nur schwer einer malerischen Richtung zuordnen. Seine von Heinrich Heine beeinflusste lyrische Dichtung und seine Prosatexte stie?en beim Publikum, das mit dem Namen Wilhelm Busch Bildergeschichten verband, auf Unverstandnis. Die Abnahme seiner kunstlerischen Hoffnungen und das Ablegen uberhohter Erwartungen an das eigene Leben sind Motive, die sich sowohl in seinen Bildergeschichten als auch in seinem literarischen Werk wiederfinden. ********de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Busch |
Frank Schatzing
Frank Schatzing, geboren 1957, veroffentlichte 1995 den historischen Roman Tod und Teufel, der bis heute eine Auflage von 250.000 Exemplaren erreicht hat. Nach zwei weiteren Romanen und einem Band mit Erzahlungen erschien 2000 der Bestsellerroman Lautlos, ein politischer Thriller uber den Weltwirtschaftsgipfel 1999, den die Presse als »schillernde Momentaufnahme des ausgehenden Jahrtausends« lobte. Frank Schatzing lebt und arbeitet in Koln und erhielt den KolnLiteraturpreis 2002. Fur Der Schwarm wurde er von den Lesern der Krimi-Couch mit dem Krimi-Blitz fur den besten Krimi 2004 ausgezeichnet. Krimis von Frank Schatzing: (1995) Tod und Teufel * (1996) Mordshunger (1997) Die dunkle Seite (1997) Keine Angst (2000) Lautlos (2004) Der Schwarm *(Krimi-Blitz 2004) (2009) Limit |
Seine Werke
Borchert schrieb meistens Draman, Gedichte und Geschichten. Als er nur siebzehn Jahre alt war, war Reiterlied (1938) sein erstes veroffentliches Gedichte. Seine bekannten Werke sind Die Hundeblume (1947) und Drau?en vor der Tur (1947). Einige bekannte Geschichten sind An diesem Dienstag (1947), Der viele viele Schnee (1941) und Dann gibt es nur eins! (1947). Die Werke Borcherts beinhalten seine Erlebnisse mit Krieg, Gefangnis und Krankenhausern. Sie sprechen uber den Geisteszustand der Soldaten und der Menschen. Sie haben eine tiefe Psychologie und sind sehr kompliziert und gewitzt. Sie sind schwierig zu lesen, weil Borchert unvollstandige Gedanken und Satze benutzt, um die Komplexitat, Verrwirung und Geisteskrankenheit des Krieges zu zeigen. |
Im Jahre 1945 wurde Borchert durch die Franzosen verhaftet, aber wahrend er in dem franzosischen Kriegsgefangnis war, floh er nach Hamburg. Er arbeitete ein bi?chen mit der Hamburger Schauspielgesellschaft, aber wegen Krankheit mu?te er viel Zeit im Bett bleiben. Troztdem schrieb er viele Werke im Bett. Borchert wohnte 1946 bei den Eltern wieder, aber als er noch mehr Werke schrieb, wurde er immer kranker.
Freunde von Borchert planten eine Reise fur ihn in die Schweiz, um ihn gesund zu machen, und er fuhr am 22. September nach Basel ab. Die Freunde blieben aber in Deutschland, so fuhlte er sich in der Schweiz sehr einsam. In Basel schrieb er aber immer noch. Wolfgang Borchert starb am 20. November 1947 von einem Leberleiden im Clara-Spital in Basal. |
Er fand aber Zeit, seine Lieblingsarbeit zu machen: er nahm Schauspielerunterricht bei Helmuth Gmelin. Im Jahre 1940 machte Borchert eine Schauspielerprufung, nach der er eine Stelle bei der Landesbuhne Osthannover in Luneburg bekam. Er war bei der Landesbuhne bis Juni 1941, als er ins Militar gehen mu?te. Er war Panziergrenadier, und im Winter 1941 fuhr er an die Ostfront. An der Ostfront erfuhr er viele Dinge, die seine Werke spater beeinflu?ten. In Ru?land litt er auch das erste Mal an Gelbsucht; diese Krankheit wurde ihn das ganze Leben belasten. Er hatte auch eine zweite Erfahrung mit der Haft, als er im Mai 1942 drei Monate in Einzelhaft in Nurnberg verbrachtet. Im August wurde er wieder wegen Kritiken gegen die Naziregierung untersucht. Danach war er sechs Wochen im Gefangnis. Im Dezember 1942 ging er an die Ostfront zuruck.
Weil er wieder sehr krank wurde, wurde Borchert mit Fleckfieber in das Seuchenlazarett Smolensk gebracht. Als er das Krankenhaus verlie?, bekam er viele verschiedene Einsatze. Im November 1943 sollte Brochet vom Militar entlassen werden, weil er untauglich war. Aber einen Tag vor der Entlassung wurde er wegen politischer Witze denuziert, und er mu?te im Militar bleiben. Er wurde wieder verhaftet und sa? neun Monate im Gefangnis Berlin-Moabit. Im September 1944 wurde er endlich als Fiendbewahrung aus dem Militar entlassen. |
Wolfgang Borchert (1921-1947)
Matthew Cline Sein Lebenslauf Wolfgang Borchert wurde am 20. Mai 1921 in Hamburg geboren. Sein Vater Fritz war Lehrer an einer Volksschule in Hamburg-Eppendorf, und seine Mutter Hertha war Schriffstellerin. Nicht so viel ist uber seine Kindheit bekannt. Er war ein gewitztes Kind, und es gefiel ihm sehr zu lachen; er war auch ein bi?chen exzentrisch. Weil er keine Geschwester hattte, wurden die Nachbarschaftskinder seine Spielkameraden. In der Schule hatte Borchert keinen gro?en Erfolg. Im Jahre 1928 ging er in die Volksschule, und 1932 in die Oberrealschule. Seine Lehrer sagten, er sei kein guter Schuler gewesen. Borchert verlie? 1938 die Schule. Seinen Eltern sagte er, da? er Schauspieler werden wolle. Das gefiel aber den Eltern nicht, weil die Arbeit eines Schauspielers sehr unsicher war. Gegen seine Wunsche wurde Borchert schlie?lich Lehrling bei der Buchhandlung Heinrich Boysen. Er wollte nicht Buchhandler werden, aber er machte diese Arbeit, weil er mu?te. In dieser Zeit hatte Borchert seine erste Erfahrung mit den Nazis. Er wurde von der Gestapo wegen eines Gedichtes, die er in der Buchhandlung vorgelesen hatte, verhaftet und verhortet. |
Eva Strittmatter
Eva Strittmatter, geborene Braun (* 8. Februar 1930 in Neuruppin; † 3. Januar 2011 in Berlin), war eine deutsche Dichterin und Schriftstellerin. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Leben Eva Strittmatter legte 1947 das Abitur ab und begann an der Humboldt-Universitat zu Berlin das Studium der Germanistik, Romanistik und Padagogik. 1950 heiratete sie einen Mann auf Grund seiner Morddrohung und brachte 1951 einen Sohn, Ilja, zur Welt. Die Ehe wurde jedoch bald wieder geschieden. Noch vor der Scheidung lernte sie Erwin Strittmatter kennen, den sie 1956 heiratete und mit dem sie 3 weitere Sohne hatte, darunter der Autor und Schauspieler Erwin Berner. Seit 1951, nach dem Abschluss ihres Studiums, arbeitete Eva Strittmatter freiberuflich beim Deutschen Schriftstellerverband der DDR als Lektorin. Ab 1952 veroffentlichte sie literaturkritische Arbeiten in der Literaturzeitschrift ndl. Von 1953 bis 1954 war sie Lektorin beim Kinderbuchverlag Berlin. Zudem wurde sie 1953 Mitglied des ndl-Redaktionsbeirates. Seit 1954 war sie freie Schriftstellerin. Sie veroffentlichte eher unpolitische Werke, darunter vor allem Gedichte, aber auch Prosa fur Kinder und Erwachsene. Zu ihren und den Bekannten ihres Mannes zahlten unter anderem die DDR-Schriftsteller Hermann Kant und Christa Wolf, aber auch international bekannte Schriftsteller wie Lew Kopelew und Halldor Laxness. Von 1960 bis 1972 unternahm sie in ihrer Eigenschaft als Mitglied der Auslandskommission des Schriftstellerverbandes der DDR zahlreiche Reisen in die Sowjetunion und nach Jugoslawien. 1993/1994 starben innerhalb von nur neun Monaten ihre Mutter, ihr Mann Erwin und ihr Sohn Matti. Sie lebte im brandenburgischen Schulzenhof, wohin sie 1957 mit ihrem Mann gezogen war. |
Werke
Marschenbuch. Land- und Volksbilder aus den Marschen der Weser und Elbe. Schulze, Oldenburg 1858. Romische Schlendertage. Schulze, Oldenburg 1868. Hermann Allmers (Hrsg.): Romischer Wandkalender deutscher Nation. 1884–1895. Fromm und Frei. 1889. |
Ehrungen und Tod
Zu seinem 80. Geburtstag verlieh die Universitat Heidelberg Hermann Allmers die Wurde eines Ehrendoktors der Philosophie. Franz von Lenbach malte ihn, Harro Magnussen schuf fur die Bremer Kunsthalle eine Buste. Allmers starb am 9.Marz 1902 nach kurzer Krankheit. Er ruht in einem bereits 1852 geschaffenen Gruftgewolbe auf dem Rechtenflether Friedhof unter einem aufgeschutteten baumumstandenen Hugel. |
Leben
Kindheit, Jugend, Reisen Hermann Allmers wuchs als einziges Kind wohlhabender Eltern auf. Sein Vater Wirich entstammte einer angesehenen Osterstader Bauernfamilie, seine Mutter war eine Pastorentochter aus Sandstedt. Allmers’ Eltern fuhlten sich einem aufgeklarten Christentum verpflichtet.[1] Wegen der schlechten Schulsituation in der Osterstader Marsch erhielt Allmers Unterricht durch Hauslehrer und war daruber hinaus auf autodidaktische Studien angewiesen. Der Junge interessierte sich zuerst fur Naturkunde, insbesondere die tropische Botanik. Spater weckten die Hauslehrer sein Interesse an der Antike und der Geschichte, insbesondere der Geschichte seiner Heimat. Der Vater ermoglichte dem Sohn mehrere Reisen durch Deutschland, die Alpen und Oberitalien, uber die Allmers in Prosa und Lyrik mit gro?em Erfolg in Bremer Zeitungen berichtete. In den 1840er Jahren wirkte Hermann Allmers vor allem auf dem Gebiet der Volksbildung (Grundung eines Gesangsvereins und einer Volksbibliothek), seine Motivation war dabei politisch (Allmers fuhlte sich den Zielen des Vormarz verpflichtet). Nach dem Tod des Vaters 1849 ubernahm er den elterlichen Hof. |
Hermann Allmers
Hermann Ludwig Allmers (* 11. Februar 1821 in Rechtenfleth; † 9. Marz 1902 ebenda) war ein deutscher Schriftsteller. Als Marschendichter schrieb er vor allem uber Kultur und Landschaft seiner nordwestdeutschen Heimat. |
Verfasste unter dem Pseudonym
Kol’nijer zahlreiche Reportagen, Skizzen und Erzahlungen, die in der „Saratower Deutschen Zeitung“ veroffentlicht wurden. Autor des ersten Romans aus dem Leben der Wolgadeutschen „Nor net lopper g’gewa!“ (1911). 1922-1927 Lehrer an der Deutschen Schule in Saratow, Lektor an der Saratower Universitat und Inspektor des Volkskommissariats fur Bildungswesen der Wolgadeutschen Republik. 1935 verhaftet und nach Kasachstan verbannt, durfte er 1938 wieder an die Wolga zuruckkehren. Nach der erneuten Zwangsaussiedlung 1941 war er in der Buchhaltung einer Kolchose tatig und starb in Ushur, Region Krasnojarsk. |
August Lonsinger
geb. 1881, gest. 1953 Wolgadeutscher Schriftsteller, Publizist, Padagoge und Volkskundler. Geboren in Muhlberg, verbrachte seine Jugend in Grimm an der Wolga, wo er die Zentralschule mit Auszeichnung abschloss. Bis 1910 lebte er in Zarizyn, dann in Saratow. |
Werke (Auswahl) [Bearbeiten]
Ingenieurlied, 1871 Aus der Heimat, Novellen, 1874 Vorstadtgeschichten, 1880 Drei Klange sind's, 1880 Leberecht Huhnchen, Jorinde und andere Geschichten, 1882 Im Jahre 1984, 1884 Neues von Leberecht Huhnchen und anderen Sonderlingen, 1888 Natursanger, 1888 Leberecht Huhnchen als Gro?vater, 1890 Sonderbare Geschichten, 1891 Von Perlin nach Berlin, Lebenserinnerungen, 1894, uberarbeitete Neuausgabe 2006 Leberecht Huhnchen (Gesamtausgabe), 1901, Neuausgabe im Insel Verlag, ISBN 3-458-32486-0 Heimatgeschichten (Gesamtausgabe), 1902 Reinhard Flemmings Abenteuer zu Wasser und zu Lande (3 Bde.), 1900–1906 Gesammelte Schriften, (20 Bde.) 1889–1907 Erzahlende Schriften, (7 Bde.) 1899–1900 Gesammelte Werke, (5 Bde.) 1925 |
Leben
Heinrich Seidel wurde als Sohn des gleichnamigen evangelischen Pastors Heinrich (Alexander) Seidel (1811–1861) in Perlin bei Wittenburg geboren. Er studierte Maschinenbau am Polytechnikum in Hannover und seit 1866 an der Gewerbeakademie Berlin und wurde Ingenieur. Bei den Neubauburos der Berlin-Potsdamer Bahn (1870–1872) und der Berlin-Anhaltischen Bahn (1872–1880) konstruierte er Bahnanlagen wie die Yorckbrucken und entwarf die damals in Europa einmalige Hallenkonstruktion des Anhalter Bahnhofs mit einer Spannweite von 62,5 Metern. 1880 gab er sein, wie er in den Lebenserinnerungen Von Perlin nach Berlin schreibt, „sonderbares Doppelleben“ auf und widmete sich ausschlie?lich der Schriftstellerei. Seidel war Mitglied im Akademischen Verein Hutte, kurz HUTTE, in der literarischen Gesellschaft Tunnel uber der Spree und Grundungsmitglied der mecklenburgischen Landsmannschaft Obotritia, dem spateren Corps Obotritia Darmstadt.[1]. Die Anfange der Landsmannschaft Obotritia hat er in seinem Buch Von Perlin nach Berlin als Leberecht Huhnchen beschrieben. Unter dem Pseudonym Johannes Kohnke wirkte er neben Julius Stinde (Pseudonym Theophil Ballheim), Johannes Trojan und anderen im Allgemeinen Deutschen Reimverein (ADR) mit. Der beruhmte Spruch „Dem Ingenieur ist nichts zu schwer“ ist sein Motto gewesen und erste Zeile seines Ingenieurlieds[2] von 1871. |
Heinrich Friedrich Wilhelm Karl Philipp Georg Eduard Seidel (* 25. Juni 1842 in Perlin, Mecklenburg-Schwerin; † 7. November 1906 in Gro?-Lichterfelde bei Berlin) war ein deutscher Ingenieur und Schriftsteller. ( Wikipedia)
|
Hans Fallada
Der deutsche Schriftsteller Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen (* 21. Juli 1893 in Greifswald; † 5. Februar 1947 in Berlin) – Pseudonym Hans Fallada ? gehort zu den bekanntesten deutschen Autoren des 20. Jahrhunderts. In der Literatur sind seine Werke zum uberwiegenden Teil der Richtung Neue Sachlichkeit zuzurechnen. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Leben und Werk. Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen wurde 1893 in Greifswald in gutburgerlichen Verhaltnissen geboren. 1899 zog die Familie nach Berlin und 1909 nach Leipzig – sein Vater war dort zum Richter am Reichsgericht berufen worden. Ditzen litt unter dem Verhaltnis zum Vater, der auch fur seinen Sohn eine Juristenlaufbahn vorgesehen hatte und ihm nicht die notige Anerkennung zollte. Wie schon in Berlin, galt er in der Schule als Au?enseiter und zog sich immer mehr in sich selbst zuruck. Auch wahrend einer kurzzeitigen Mitgliedschaft in der Wandervogelbewegung konnte er keinen besseren Kontakt zu Gleichaltrigen herstellen. Weil er in Leipzig einem ihm nur sehr fluchtig bekannten Madchen nachstellte ? er hatte dem Madchen auch Liebesbriefe geschrieben – schickten ihn seine Eltern nach Rudolstadt. Dort besuchte er das Furstliche Gymnasium. Mit seinem Freund Hanns Dietrich von Necker beschloss er am 17. Oktober 1911, einen als Pistolenduell getarnten Doppelsuizid zu begehen. Bei dem Duell starb sein Freund, wahrend Ditzen schwer verletzt uberlebte. Er wurde wegen Totschlags angeklagt und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Wegen Schuldunfahigkeit wurde die Anklage fallengelassen. Er verlie? das Gymnasium ohne Abschluss. mehr: Hans Fallada – Wikipedia de.wikipedia.org/wiki/Hans_Fallad |
| Òåêóùåå âðåìÿ: 15:45. ×àñîâîé ïîÿñ GMT. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Ïåðåâîä: zCarot